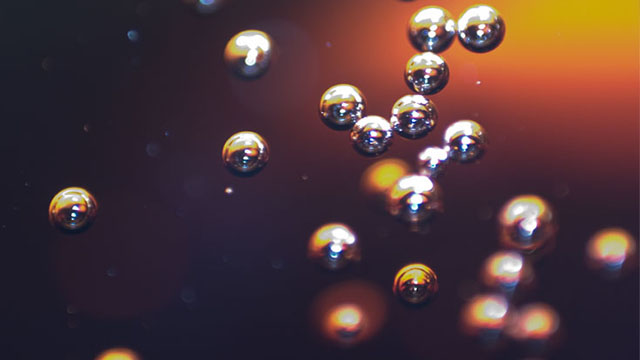Entwurf für ein Positionspapier der Bundestagsfraktion Die Linke
Die deutschen Klimaziele für 2030 und später drohen verfehlt zu werden. Im Zuge dessen wird der Ruf nach CO₂-Entfernung aus Luft, Abgasen und Meerwasser immer lauter. Gleichzeitig gab es in den letzten Jahren neues Wissen zu solchen Technologien. Die Linke muss sich zu den einzelnen Methoden positionieren und dabei zwischen sinnvollem Einsatz und Deckmantel der fossilen Industrie unterscheiden. Dies muss entlang wissenschaftlicher Erkenntnisse und unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Folgen geschehen. Dabei ist klar: Die Vermeidung von Treibhausgasemissionen bleibt erste Priorität. »Klimaneutralität« ist leider zu oft ein falsches Versprechen – es gilt das Vorsorgeprinzip. Denn im Zweifel müssen Risiken abgewogen und unbeabsichtigte Konsequenzen vermieden werden. Durch CO2-Entfernung darf nicht die Natur zerstört werden, die durch den Klimawandel bedroht ist. Folgende Ansätze werden im Besonderen in der Fachwelt und der Zivilgesellschaft diskutiert.
Wälder, Waldumbau und Wiederaufforstung: Dieser Ansatz sollte unterstützt werden. Aktuell setzt der Wald mehr Kohlenstoff frei, als er aufnimmt. Nachhaltig bewirtschaftete und an Klimaveränderungen angepasste Wälder speichern hingegen CO₂ und stellen wertvolle Ökosysteme dar. Sie dienen außerdem der Erholung und ermöglichen das Erleben von Natur. Zudem kann durch langfristige Holznutzung, etwa Bauholz, CO₂ auch außerhalb von Wäldern langfristig gespeichert werden. Ein Teil der Fläche sollte für den Biodiversitätserhalt besonders streng geschützt werden, darunter 5% Wildnisfläche. Diskutiert wird eine globale Ausdehnung der Waldfläche in großem Umfang. Dies lehnen wir ab, um genügend Flächen für Ernährung, Biodiversitätserhalt und Klimaschutz zu haben. Wiederaufforstung und den Schutz von Wäldern unterstützen wir ausdrücklich.
Moore speichern große Mengen CO₂ und sind daher zu schützen und wiederzuvernässen. Da viele trockengelegte Moore heute land- und forstwirtschaftlich genutzt werden, setzen wir auf Lösungen, die für Land- und Forstwirt*innen tragfähig sind. Seegraswiesen könnten erhebliche Mengen CO₂ binden und fördern Biodiversität. Für eine großflächige Ausweitung von Seegraswiesen sind jedoch weitere Forschungsergebnisse abzuwarten. Schutzmaßnahmen für bestehende Seegraswiesen sind zu stärken, auch durch Totalreservate. In jedem Fall ist der Einsatz nur begrenzt möglich. Es wird im Zuge des Ausbaus von Offshore-Windparks dazu kommen, dass Seegraswiesen Infrastruktur weichen. Das muss durch Ausgleichsflächen (über)kompensiert werden.
Carbon Capture and Storage (CCS) ist die Abscheidung und Speicherung von CO₂. Wir lehnen CCS in Deutschland ab. Es verzögert den Ausstieg aus fossilen Energien, statt ihn zu beschleunigen. Mit dem dafür nötigen Geld sollten besser erneuerbare Energien ausgebaut, statt durch risikohafte CO2-Speicherung fossiler Kraftwerke gehemmt werden. Zwar wird CCS oft als notwendig für sogenannte »unvermeidbare Emissionen« dargestellt – doch die Realität sieht anders aus: So soll CCS auch für den Gaskraftwerksbetrieb und für sogenannten blauen Wasserstoff aus Erdgas genutzt werden. Gaskraftwerke werden nach Plan der Regierung als Backup verwendet. Investitionen in CCS-Technologie verdoppelt den Preis für diese Technologie, die allerdings nicht wie Gaskraftwerke flexibel an- und ausgeschaltet werden kann. CCS für Gaskraftwerke ist daher nicht sinnvoll. Zudem speichert CCS nur einen Teil der CO2-Emissionen. Aus diesen Gründen möchten Wir CCS in Deutschland verbieten.
Für den Transport und die geologische Speicherung unter dem Meer (offshore) wären neue Pipelines und Speicheranlagen nötig. Diese Infrastruktur ist teuer, aufwendig und mit Risiken verbunden. Pipelines lohnen sich absehbar nur für Unternehmen, wenn auch vermeidbare Emissionen mittransportiert würden – das widerspricht der Emissionsvermeidung, die immer Vorrang haben muss. Pipelines hauptsächlich für CO₂ aus dem Ausland lehnen wir ebenfalls ab. Hinzukommen Umweltgefahren: Die Offshore-Speicherung ist bislang nicht ausreichend erforscht. Es gibt zu wenige Daten über potenzielle Lecks und alte Bohrlöcher; geologische Voraussetzungen sind vielerorts nicht erfüllt. Untersuchungen würden den Baubeginn deutlich verzögern. Emissionen beim Bau der Anlagen und Leitungen, insbesondere nahe Schutzgebieten, wären nicht zu vermeiden. Und eine sichere Speicherung über viele Generationen kann nicht garantiert werden. CCS rund um Meeresschutzgebiete ist grundsätzlich auszuschließen, nicht zuletzt, um das Weltnaturerbe Wattenmeer zu erhalten. Durch CCS und Pipelines steigt zudem die Flächenkonkurrenz weiter an. An Land (onshore) sind die Risiken besonders groß: CO₂ könnte ins Grundwasser gelangen und damit Trinkwasser gefährden. In einem so dicht besiedelten Land wie Deutschland ist das nicht verantwortbar.
CCS außerhalb Deutschlands sehen wir kritisch, schließen es aber nicht aus, wenn ökologische, soziale und geologische Voraussetzungen erfüllt sind. Den Export von CO₂ zur Speicherung in andere Weltregionen ist aus Gründen globaler Gerechtigkeit nicht vertretbar. Innerhalb Europas könnte es Standorte geben, wo CCS vertretbar wäre. Doch die potenziellen Speicher sind begrenzt, ihr Aufnahmevolumen wird überschätzt. Innerhalb dieses begrenzten Rahmens kann CCS in Europa zur Lösung tatsächlich unvermeidbarer Emissionen beitragen.
Bei unvermeidbaren Emissionen für Produkte, deren Produktion nicht in direkter internationaler Konkurrenz steht, ist jedoch von Subventionen abzusehen. Hier sollte der CO2-Preis seine Wirkung voll entfalten, um Einsparungen und Produktsubstitutionen zu stimulieren. CCS bei unvermeidbaren Emissionen anderer Produktionsprozesse kann dagegen auch durch Subventionen unterstützt werden. Die CCS-Technologien sollen global freigegeben werden, um anderen Staaten die Speicherung zu ermöglichen, wenn dort soziale, ökologische und geologische Voraussetzungen erfüllt sind.
Dennoch muss die Priorität klar sein: Wir setzen in Deutschland bei der CO2-Entfernung auf naturbasierte Lösungen wie die Wiedervernässung von Mooren, Aufforstung und Renaturierung. Sie sind erprobt, ökologisch sinnvoll, gesellschaftlich akzeptiert – und sie helfen, unvermeidbare Emissionen auszugleichen, ohne neue Risiken zu schaffen.
Biokohle, also verkohlte Biomasse, könnte in der Landwirtschaft CO₂ langfristig binden und gleichzeitig die Bodenfruchtbarkeit erhöhen. Das kann sinnvoll sein, wenn sie ohnehin zur Bodenverbesserung eingesetzt wird, insbesondere im Gartenbau bei Böden mit niedriger Nährstoff- und Wasserhaltekapazität. Der großflächige Einsatz in Deutschland ist jedoch abzulehnen, da hohe Kosten und Ressourcenkonflikte durch den Anbau von Biomasse für diesen Zweck bestehen, insbesondere mit der Nahrungsmittelproduktion.
Bioenergy with Carbon Capture and Storage (BECCS): Die Idee hinter BECCS ist, durch Biomasse Strom zu erzeugen und das entstehende CO₂ abzuscheiden, um CO₂ aus der Atmosphäre zu entfernen. Wir halten diese Technologie nicht für eine zukunftsfähige Klimaschutzmaßnahme. Zwar kann die begrenzte Nutzung von Bioenergie aus Reststoffen der Landwirtschaft und ggf. aus Bioabfällen der Haushalte sinnvoll sein, um flexibel Strom bereitzustellen, wenn Wind und Sonne nicht ausreichen. Doch der großflächige Anbau von Energiepflanzen für BECCS würde Böden, Wasser und Flächen in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion und zur Biodiversität setzen. Dadurch entstehen neue soziale und ökologische Risiken.
Carbon Capture and Utilization (CCU): Die Abscheidung und stoffliche Nutzung von CO₂ kann dort sinnvoll sein, wo unvermeidbare Emissionen entstehen – etwa in Teilen der Chemie- und Stahlindustrie. In solchen Fällen befürworten wir den gezielten Einsatz vor Ort, an der Punktquelle, insbesondere bei dauerhafter Bindung in Baustoffen inklusive Zement. CCU ist mit hohen Kosten und erheblichem Energieeinsatz verbunden und meist erfolgt die Bindung nicht langfristig. Eine flächendeckende Einführung oder staatliche Subventionierung von CCU-Technologien lehnen wir daher ab. CCU darf nicht als Feigenblatt für fossile Geschäftsmodelle dienen.
CCU ist für unvermeidbare Emissionen eine Option. Aber: Es gibt keine allgemeingültige Definition, was tatsächlich unvermeidbar ist. Nur, weil ein Prozess trotz aller Mühen nicht emissionsfrei zu bekommen ist, muss die Lösung nicht automatisch »CCU« heißen. Bei Zement gibt es die bekannten Potentiale, durch Reduzierung des Klinkeranteils mit weniger Emissionen auszukommen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Zement und Beton als Baustoff zu vermeiden. Eine Kreislaufwirtschaft auch für Gebäude könnte klimapolitisch effektvoller sein als jeglicher Gedanke über eine CO2-Infrastruktur. Mit mehr Einsatz von biologischen Baustoffen wie Holz kann Kohlenstoff über Jahrzehnte aus der Atmosphäre entfernt werden.
Unvermeidbare Emissionen entstehen auch bei der Müllverbrennung. Konsequente Kreislaufwirtschaft, deutlich höhere Recyclingquoten und entsprechendes Produktdesign und eine Logistik, die mit wenig Verpackung auskommt, sollten hier vor jedweder Debatte um CO2-Verpressung stehen. Methan- und Lachgasemissionen aus der Landwirtschaft können mit stärkerem Engagement für mehr pflanzenbasierte Ernährung erheblich gesenkt werden, während gleichzeitig Flächenkonflikte gelöst und natürliche Kohlenstoffsenken besser reaktiviert werden.
Welche Emissionen tatsächlich unvermeidbar sind, ist nicht nur eine Frage politischer Rahmen für die Industrie. Sie ist auch Ausdruck einer ökologischen und sozialen Agrar- und Ernährungspolitik. Letztendlich zielt sie darauf ab, tradierte Wirtschafts- und Konsumbeziehungen in eine sozial-ökologische Zukunft zu wandeln.
Direct Air Capture (DAC), also das technische Entfernen von CO₂ aus der Atmosphäre, lehnen wir ab. Es wird – auch langfristig – als zu energie- und kostenintensiv eingeschätzt.
Algenblüten: Das Ausbringen von Nährstoffen auf dem Ozean zur Anregung von Algenblüten zur Speicherung von CO₂ lehnen wir ab. Es ist nicht gesichert, dass auf diese Weise große Mengen CO₂ in der Tiefsee gespeichert werden können. Negative Auswirkungen auf marine Ökosysteme und Nahrungsketten, auch in großer Entfernung, wären zu erwarten. Zudem ist unklar, woher die Nährstoffe kommen sollen, ohne dabei anderswo Umweltprobleme zu schaffen. Schon heute führen Algenblüten durch Nährstoffeintrag aus der Landwirtschaft zur Bedrohung maritimer Ökosysteme. Ferner ist unklar, wie das finanziert wird.
Ozeandüngung: Das Ausbringen von Mineralien (Silikatgestein) oder alkalischen Lösungen (Natrium- oder Kaliumhydroxid) auf dem Ozean zur geochemischen Bindung von CO₂ im Meerwasser lehnen wir ab. Zwar könnte auf diese Weise CO₂ aus dem Wasser gebunden werden. Allerdings ist dafür eine Industrie in der Größenordnung des Kohleabbaus notwendig, inklusive ökologischer Folgen. Und es ist unklar, wie dauerhaft die CO₂-Bindung tatsächlich ist, woher die Rohstoffe kommen, wie das finanziert wird und wie sich dies auf marine Ökosysteme auswirkt, auch in großer Entfernung.
Silikatgestein könnte als Gesteinsmehl in der Land- und Forstwirtschaft ausgebracht werden und so CO₂ aus der Luft binden. Das ist dann sinnvoll, wenn es ohnehin zur Bodenverbesserung eingesetzt wird. Allerdings ist der Abbau ressourcenintensiv, und die Auswirkungen auf Bodenökosysteme und Wasserqualität sind noch nicht ausreichend erforscht. Der großflächige Einsatz von Silikatgestein ist daher abzulehnen, auch, da die Kosten und Umweltauswirkungen nicht im Einklang mit dem Nutzen stehen.
Die Zucht von Seetang in Küstennähe oder im offenen Ozean wird als mögliche Methode diskutiert, um CO₂ nach Absterben der Algen in der Tiefsee zu binden. Allerdings müsste diese Kultivierung in großem Maßstab durch Düngung (mineralisch oder organisch) unterstützt werden, was Risiken für die marinen Ökosysteme und Nahrungsketten birgt. Zudem sind die ökologischen und sozialen Folgen noch nicht ausreichend erforscht. Deshalb sehen wir diesen Ansatz derzeit kritisch.
Abscheidung aus dem Meerwasser ist ein Prozess, der CO₂ aus dem Meerwasser entfernt und entweder mit Strom oder chemisch funktioniert. Beides hätte Folgen für maritime Ökosysteme und ist teuer. Die Dauerhaftigkeit der CO₂-Bindung ist schwer zu bewerten. Wir lehnen diese technischen Ansätze ab.
Künstlicher Auftrieb, also durch Röhren nährstoffreiches Meerwasser aus der Tiefe an die Oberfläche zu leiten, ist noch nicht ausreichend erforscht. Es sind ökologische Folgen zu erwarten – positive und negative. Die Dynamik der Veränderung der Meeresoberflächen in den vergangenen Jahren führt allerdings zu wachsenden ökologischen und klimatologischen Problemen. Erkenntnisse zur CO₂-Speicherung sind außerdem unzureichend.
Konkrete Forderungen
- Wir lehnen Fracking und CCS in Deutschland ab und fordern einen Beschluss dazu.
- CO₂-Exporte sind nur dann zu erlauben, wenn ökologische, soziale und geologische Voraussetzungen erfüllt sind.
- Eine Frage der globalen Gerechtigkeit ist der Ausschluss von CO₂-Transporten außerhalb Europas und damit auch der Schutz indigener Völker. Wir fordern das Verbot solcher Transporte.
- Patente auf Schlüsseltechnologien zur CO₂-Entfernung müssen global freigegeben werden, damit auch andere Staaten diese Technologien nutzen können.
- CO₂-Entfernung muss demokratisch legitimiert erfolgen und darf nicht dem Gewinninteresse von Konzernen dienen.
- Obwohl in den letzten Jahren zahlreiche neue Erkenntnisse zu technischen Möglichkeiten für negative Emissionen gewonnen wurden, bedarf es zu einigen Technologien weitere Forschung. Wir fordern die Finanzierung solcher Forschungsprojekte.
- Forschung ist auch für die weitere Dekarbonisierung unvermeidbarer Emissionen notwendig, etwa in der chemischen Industrie.
- Bei den beschriebenen Technologien ist die Beteiligung der Bevölkerung besonders wichtig. Eine Einschränkung der Beteiligungsrechte lehnen wir ab. Im Gegenteil: Beteiligungsprozesse sind bei konkreten Planungen früh zu ermöglichen. Planungsprozesse sind durch eine bessere Ausstattung von Behörden und bessere Arbeitsbedingungen inkl. Digitalisierung zu beschleunigen.
- CO₂-Pipelines sind nur für lokale Strecken zugelassen. Ein Pipeline-Netz lehnen wir ab, auch für Emissionen aus Nachbarstaaten.
- CO₂-Entnahme darf nicht zur Ausstellung von Kompensationszertifikaten führen, die fossile Emissionen legitimieren. Den internationalen Zertifikatehandel lehnen wir aus Gründen der globalen Gerechtigkeit und vor dem Hintergrund zahlreicher Betrugsfälle ab. Vor diesem Hintergrund sind auch etwaige staatliche Kredite und Bürgschaften besonders zu prüfen.
- CCU ist genehmigungspflichtig und folgt den üblichen Bestimmungen insbesondere nach UVP und BImSchG.
- CCS ist nicht nachhaltig im Sinne der EU-Taxonomie. Wir setzen uns dafür ein, dass auf EU-Ebene keine Änderungen daran durchgesetzt werden.
- Wir fordern ein Verbot von Importen von blauem und grauem Wasserstoff.
Geplante Änderungen des Kohlendioxid-Speicherungsgesetz (KSpG)
Die Regierung plant eine Änderung des KSpG. Nachfolgend positionieren wir uns zu den dort angestrebten Änderungen.
- Wir sind gegen CCS.
- Wir sind gegen Pipeline-Infrastruktur sowohl für CCS als auch für CCU. Lokale Pipelines für CCU befürworten wir, lehnen den Rechtsrahmen jedoch insgesamt ab.
- Wir sind insbesondere gegen Speicherung an Land.
- Emissionen aus fossilen (Gas-)Kraftwerken sollen nicht abgeschieden werden dürfen.
- Der Gesetzentwurf bezieht sich auf den Oberbegriff Carbon Dioxide Removal (CDR), das beinhaltet neben CCS auch BECCS (Emissionen aus Bioenergie) und DAC (Abscheidungen aus der Luft), lässt also »Technologieoffenheit« zu. DAC ist auszuschließen.
- Wir lehnen ab, dass es sich bei der gesamten CCS- und CO2-Infrastruktur um »überragendes« öffentliches Interesse handelt. Umwelt- und Naturschutzbelange sowie Beteiligung sind sicherzustellen.
- Öffentlicher Dialog und Streitschlichtung waren im Entwurf der alten Regierung als Strategien bei der Straffung von Genehmigungsverfahren (siehe voriger Punkt) vorgesehen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir lehnen zwar bereits die Straffung ab, Dialog und Streitschlichtung können wir trotzdem fordern.