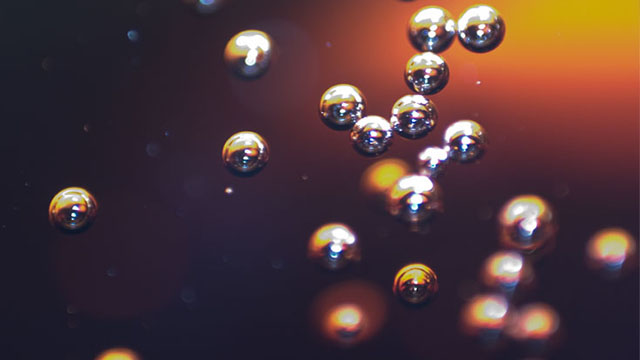Die Bundesregierung setzt große Hoffnungen auf eine Technologie, die verspricht, die Klimakrise zu lösen, ohne allzu viel am fossilen Kapitalismus ändern zu müssen: CCS – die Abscheidung und Speicherung von CO₂. Das Verfahren soll Emissionen aus Industrieanlagen auffangen und tief unter der Erde lagern. Klingt technisch eindrucksvoll – und politisch bequem. Doch hinter dieser angeblichen Lösung verbirgt sich ein klassisches Muster: Statt endlich entschlossen Klimapolitik zu machen, wird das Problem verschoben, externalisiert und am Ende profitabel verwertet. Ein vertrautes Muster im Kapitalismus, der seine Krisen systematisch zur Ware macht.
In der öffentlichen Debatte spricht heute kaum noch jemand von echter Emissionsreduktion. Stattdessen dominiert das Narrativ der „Netto-Null“. Das bedeutet: Es darf weiter ausgestoßen werden, solange irgendwo anders, durch technische oder natürliche Maßnahmen, eine gleich große Menge CO₂ „eingespart“ oder „gebunden“ wird. Diese Bilanzierung ersetzt den dringend nötigen Ausstieg aus Fossilen durch Rechentricks.
CCS ist dabei das zentrale Versprechen: Man könne CO₂ entsorgen, als wäre es Müll. Die Emissionen dürfen bleiben, die Technik wird’s schon richten. Doch genau dieses Versprechen erlaubt es Konzernen wie Heidelberg Materials, RWE oder BASF, ihr fossiles Geschäftsmodell fortzusetzen und sich gleichzeitig als klimafreundlich zu inszenieren. Auch, weil die Investitionen größtenteils vom Staat kommen. Kosten und Risiken – Infrastrukturbau, Speicherlecks, Langzeitüberwachung – werden externalisiert. Und die Profite sichern fossile Marktanteile. Dabei stammt die Technologie zur Verpressung von CO₂ aus der Erdölförderung, wo sie genutzt wird, um noch mehr Öl aus Lagerstätten zu fördern.
Damit wird deutlich: CCS steht nicht für Klimaschutz, sondern für die Kommodifizierung der Klimakrise. CO₂ wird zur handelbaren Ware, Speicherung zum profitablen Geschäftsmodell. Es richtet sich nicht nach ökologischen Notwendigkeiten, sondern nach ökonomischen Interessen. Und genau deshalb findet es auch breite Unterstützung bei der CDU, SPD und – konsequenterweise – den Grünen. Wer einmal beschlossen hat, dass „grünes Wachstum“ möglich sein muss, der braucht Technologien wie CCS, um die Widersprüche zwischen Kapitalverwertung und Klimaschutz kosmetisch zu überbrücken.
Der Preis dafür ist hoch: Statt Investitionen in die sozial-ökologische Infrastruktur zu lenken, z. B. in Erneuerbare und Speicher, ÖPNV, Gebäudesanierung, Moorschutz, Aufforstung oder agrarökologische Betriebe, sollen Milliarden in Projekte gepumpt werden, die in erster Linie die Verlängerung des Fossilen ermöglichen. Wer so handelt, verhindert den notwendigen Umbau und verschiebt die Kosten in die Zukunft.
Dabei ist in der Klimaforschung die Lage längst nicht so eindeutig: CCS kann weltweit nur begrenzt helfen und in Deutschland wohl gar nicht, insbesondere, weil es an geeigneten geologischen Strukturen fehlt. Ganz zu schweigen davon, dass milliardenteure Infrastruktur in Naturschutzgebieten zu errichten wäre. Doch in der politischen Kommunikation werden diese Einschränkungen regelmäßig ignoriert. Die technologische Debatte um CCS verschleiert, dass nicht die Mittel zur CO₂-Reduktion fehlen, sondern der politische Wille, den fossilen Kapitalismus zu überwinden.
Und so zahlen am Ende vor allem die Lohnabhängigen, die Mieter*innen und die Bevölkerung im „Globalen Süden“ – sei es durch steigende Energiepreise, Landgrabbing für CO₂-Senken oder durch die Verlagerung ökologischer und finanzieller Lasten auf die Allgemeinheit. Profitieren werden jene, deren Geschäftsmodell seit Jahrzehnten auf der Externalisierung von Kosten beruht.
Wenn man all das ernst nimmt, dann wird klar: Klimaschutz ist Klassenkampf. Die Debatte um CCS ist kein technischer Streit, sondern eine grundsätzliche Systemauseinandersetzung. Es geht darum, wer die Kosten der Klimakrise trägt, wer über Lösungen entscheidet und wessen Interessen politisch Priorität haben. Klimaschutz, der sich auf CO₂-Bilanzen und technologische Versprechen verlässt, ist Klimaschutz von oben, gemacht für die Profiteure der Krise, nicht für ihre Opfer. Echter Klimaschutz bedeutet, sich mit den Machtverhältnissen hinter den Emissionen auseinanderzusetzen: mit Konzerninteressen, Kapitallogik, Produktionsketten, Eigentumsfragen. Wer das Klima retten will, muss die Eigentumsverhältnisse infrage stellen.